Watt- & Tritt-Training für Mountainbiker: Leistungsoptimierung mit Powermeter
Jan Timmermann
· 21.03.2025




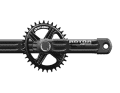

Von Watt hat wohl jeder Biker schon einmal gehört. Nicht jedem ist aber klar, was diese Maßeinheit überhaupt bedeutet und wie sie sich fürs eigene Training nutzen lässt. Biken gehört zu den am besten erforschten Ausdauersportarten überhaupt und Experten haben zahlreiche Drehschrauben gefunden, um Leistung von Radsportlern zu optimieren. Kein anderer Wert dürfte für Marathon-, Cross-Country- aber auch Tourenbiker eine so zentrale Rolle einnehmen, wie die Tretleistung. Sie wird in Watt gemessen und beschreibt, wie viel mechanische Arbeit der Körper pro Zeit leistet. Wer die eigenen Watt-Werte kennt und richtig interpretieren kann, erhält das wohl effektivste Mittel für gezielte Weiterentwicklung im Training und cleveres Pacing im Wettkampf. Zudem bietet eine präzise gemessene Leistung eine gute Grundlage für den Vergleich mit anderen Sportlern.

Die Leistung eines Sportlers gilt als entscheidender Parameter für eine optimale Trainingssteuerung. Sie bietet meist deutlich genauere Auskünfte über dessen Fitness als andere Messwerte, wie etwa die Herzfrequenz. Der Puls unterliegt beim Biken vielen Störfaktoren, wie etwa der Temperatur, Emotionen, Wasserverlust oder Ernährung. Schon der Espresso vor dem Training kann die Werte beeinflussen. Zudem ist der Pumpmuskel Herz ein eher langsamer Geselle und auf plötzliche Intensitätsveränderungen, wie etwa bei kurzen Intervallen, reagiert die Herzfrequenz nur träge. Das Training nach Watt-Werten verspricht eine gleichbleibende Genauigkeit und lässt Fortschritte ohne Zeitverzögerung erkennen. Vor allem aber ist die in Watt gemessene Leistung Berechnungsgrundlage für weitere wichtige Kennzahlen, wie etwa Trainingszonen oder Energiebedarf. So lässt sich Leistung in Watt auch als Energiefluss in Joule pro Sekunde bezeichnen. Wer seine Leistung mit der entsprechenden Zeit in Sekunden multipliziert, erhält Auskunft über die mechanische Energie in Kilojoule, welche wiederum näherungsweise dem Nahrungsbedarf in Kilokalorien entspricht.

Watt-Messung mit Powermeter
Dass Watt-Training für Radsportler optimal ist, erkannte man bereits früh. Das erste funktionstüchtige Powermeter kam schon 1986 auf den Markt. In den Neunzigern experimentierten erste Straßenradprofis mit der Wattmessung. In fast 40 Jahren Entwicklungsgeschichte hat sich eine Menge getan. Nicht nur, dass die Technik erheblich verkleinert werden konnte, die heutige Generation der Powermeter ist vor allem genau und verlässlich. Beides ist für eine präzise Trainingssteuerung unerlässlich. So kann bereits eine Ungenauigkeit von fünf Prozent die gemessene Leistung bedeutend verfälschen. Bei klassischer Messung im Kurbelstern bleibt zum Beispiel offen, was die Beine in der Zugphase leisten und Ungenauigkeiten in der Rechts-Links-Verteilung sind wahrscheinlicher. Powermeter mit einseitiger Messung sind preislich attraktiv aber meist deutlich ungenauer als Modelle mit dualer Messung. In unseren Tests waren 20 Watt Messunterschied keine Seltenheit. Wer ambitioniert trainieren will, sollte also nicht nur auf die Kompatibilität mit Kurbeln und Rahmen, sondern auch auf Genauigkeit achten. Wie bei jeder guten Messtechnik, kosten Powermeter inklusive hochwertiger Kurbelarme gerne 1000 Euro und mehr.
Produktbeispiel: Rotor 2INpower MTB DM
- Preis: 999 Euro >> hier erhältlich
- Gewicht: 695 g (170 mm)
- Leistungsmessung: beidseitig
- Messungenauigkeit: +/- 0,5 %
- Datenübertragung: ANT+TM- / Bluetooth
- Energieträger: Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
- Akkulaufzeit: ca. 250 h
- Achsdurchmesser: 30 mm
- Kettenlinie: 52 mm Boost
- Längen: 165 / 170 / 175 mm

Wattmess-Pedale
Eine Alternative zu den kurbelgebundenen Powermetern bieten sogenannte Wattmess-Pedale. Auch für den Mountainbike-Bereich gibt es inzwischen eine Auswahl an in die Klickpedale integrierte Powermeter. Der Vorteil: Die Pedale lassen sich von Bike zu Bike übertragen und haben im Gegensatz zu Kurbeln quasi keine Kompatibilitätsprobleme. Unsere Tests bescheinigen den aktuellen Pedalpowermetern eine gute Genauigkeit und Haltbarkeit. Günstig sind leider auch Wattmess-Pedale nicht.
Produktbeispiel: Garmin Rally XC200
- Preis: 999 Euro >> hier erhältlich
- Gewicht: 444 g
- Leistungsmessung: beidseitig
- Messungenauigkeit: +/- 1 %
- Datenübertragung: ANT+ / Bluetooth
- Energieträger: Batterie
- Akkulaufzeit: ca. 120 h
- Cleat-System: Shimano SPD

Der FTP-Test: Dreh- und Angelpunkt für die Trainingssteuerung
FTP steht für “Functional Threshold Power” und beschreibt die maximale Durchschnittsleistung über eine Stunde. Auch als funktionelle Schwellenleistung bezeichnet, lässt der FTP-Wert wichtige Rückschlüsse auf die Optimierung des Radtrainings zu. Für die meisten Biker sind zehn bis 20 minütige FTP-Tests besser umzusetzen, als ein 60 minütiger Testzeitraum. Die Leistung pro Stunde kann auch aus FTP10 und FTP20 errechnet werden. Die entsprechenden Test-Programme sind in den meisten Softwares der Powermeter-Hersteller oder anderen kompatiblen Apps zur Trainingssteuerung hinterlegt. Ein FTP-Test kann eine professionelle Leistungsdiagnostik mit Laktatmessung nicht ersetzen aber relativ unkompliziert und ohne fremde Hilfe umgesetzt werden. Wie ein FTP-Test im Detail funktioniert und was dabei beachtet werden sollte, haben wir hier zusammengefasst. Ist der aktuelle FTP-Wert ermittelt, können die individuell optimalen Trainingszonen errechnet werden:
- Zone 1 (< 55% der FTP): aktive Regeneration nach intensivem Training oder Wettkampf
- Zone 2 (55-75% der FTP): Grundlagenausdauer (GA1) zum Training von ausdauernden Fahrten mit niedriger Geschwindigkeit
- Zone 3 (75-90% der FTP): Tempo-Training (GA2) zur Verbesserung der Geschwindigkeit bei schnellen Fahrten
- Zone 4 (90-105% der FTP): Erreichen der Laktatschwelle im Entwicklungsbereich (EB), intensives, maximal 90 minütiges Training trainiert hohe Belastungen und Laktat-Toleranz
- Zone 5 (105-120% der FTP): VO2max-Training verbessert die maximale Sauerstoffaufnahme bei schnellen Intervallen
- Zone 6 (>120% der FTP): bei intensiven Sprints bis maximal zwei Minuten verbessert sich die anaerobe Kapazität

Watt-Werte einschätzen: Wie viel Leistung bringe ich?
In unterschiedlichen Disziplinen sind unterschiedliche Leistungen gefragt. So erreichen Profis in der Sprint-Disziplin Cross-Country-Eliminator punktuell bis zu 2500 Watt Spitze und können über fünf Minuten locker über 500 Watt treten. Für längere Distanzen gibt wieder der FTP-Wert Auskunft über die Leistungsfähigkeit. Im Marathon-Bereich arbeitet kein Profi mehr ohne Watt-Messung. Weltklasse-Athleten, wie Karl Platt (70 kg) oder Alban Lakata (78 kg), erreichen eine Stundenleistung von 400 bis 420 Watt. Zur Einordnung: Damit könnte man eine Stunde lang vier LCD-Fernseher betreiben.
Für einen trainierten Amateur-Biker geht man von einer Stundenleistung um drei Watt pro Kilo Körpergewicht aus. Ab diesem Wert wird das Finishen eines MTB-Marathons realistisch. Je höher das Verhältnis aus Watt pro Kilo ausfällt, desto größer ist das Bergfahrpotential. Wer sein Tempo am Berg steigern will, kann also entweder die Leistung erhöhen oder das Körpergewicht reduzieren. Zur Einschätzung der eigenen Stundenleistung hilft folgende Matrix:
- 1 W / kg: Menschen, die nie Sport machen oder krank sind
- 2 W / kg: Untrainierte, die selten Sport machen, die schwache Leistungsfähigkeit weist auf zu wenig Bewegung hin
- 3 W / kg: Hobby-Biker mit regelmäßigem Training, Marathons sind möglich
- 4 W / kg: gute Amateure, Marathons werden auf Platzierung gefahren
- 5 W / kg: sehr gute Amateure oder Jung-Profis, wer unter 4,8 liegt, wird nicht vom Sport leben können
- 6 W / kg: sechs Watt und mehr pro Kilo treten fast nur Weltmeister, das nötige Trainingspensum können Hobby-Biker i.d.R. nicht erreichen

Der runde Tritt
Lange Zeit galt der runde Tritt als Kernkompetenz für Ausdauer-Biker. Heute hat seine öffentliche Relevanz zwar abgenommen, der runde Tritt ist aber nach wie vor eine Technik, die Mountainbiker, welche sich mit Watt-Training beschäftigen, beherrschen sollten. Powermeter erfassen auch die Trittfrequenz. Sie wird in Umdrehungen pro Minute (U/min) gemessen und ihr Optimal-Bereich ist abhängig von der Leistung. In der Ebene liegt dieser Bereich zwischen 90 und 100 U/min, am Berg deutlich darunter. Hohe Trittfrequenzen bringen in den meisten Situationen Vorteile mit - nicht zuletzt für die Kniegesundheit. Mit einem runden Tritt können hohe Frequenzen realisiert werden, ohne im Oberkörper zu viel Kraft zu verlieren. Die Trittfrequenz bestimmt nicht nur die Effizienz, wie der Körper die Leistung aufs Pedal überträgt, sondern auch die Gangwahl. Hohe Leistungen erfordern einen flüssigen Tritt. Dieser lässt sich im Gelände schwieriger realisieren, als auf der Straße, ist aber auch für Mountainbiker wichtig. Vor allem auf losem Untergrund, wo jede Lastspitze zu Traktionsverlust führen kann, hilft ein runder Tritt bei der Kraftübertragung.
Den runden Tritt trainieren
Das Gespür für den runden Tritt entwickelt sich am besten auf einem stationären Ergometer ohne Ablenkungen von außen, kann aber auch direkt auf dem Bike trainiert werden. Im ersten Schritt gilt es die Konzentration auf den Tritt zu lenken. Dazu am besten bei niedriger Trittfrequenz (40-60 U/min) versuchen den Oberkörper und die Arme ruhig zu halten. Anschließend die Frequenz steigern und den flüssigen Bewegungsablauf beibehalten. Um den Totpunkt der 12-Uhr-Stellung zu überwinden, hilft die Vorstellung man stünde auf einem Fass und und wolle dieses mit den Füßen nach vorne rollen. Für den Totpunkt in 6-Uhr-Stellung kann es helfen sich vorzustellen man wolle Dreck vom Fuß streifen. Die Motorik lässt sich auch schulen, indem zeitweise nur mit einem Bein getreten wird.


