





Sport gilt gemeinhin als gesundheitsförderlich. Fitness und Gesundheit sind für Sportler zentrale Sinnstifter. Beim Mountainbiken aber setzen Menschen ihren Körper allerhand potentiellen Gefahren aus. Stürze, Schmerzen, emotionale Tiefs und Knochenbrüche sind die unschönen Seiten des Bike-Sports. Warum also suchen wir auf dem Fahrrad immer wieder das Risiko in der nächsten Steilabfahrt, in der Ausdauer-Grenzerfahrung oder fernab der Zivilisation in der Wildnis? Diese Frage stellte sich auch Autor Jan Timmermann. Der studierte Pädagoge kam als Quereinsteiger zu BIKE: “In der Soziologie kursiert seit langem ein Modell, das erklären könnte, warum sich ausgerechnet Risikosportarten einer solchen Beliebtheit erfreuen.” Wer sich auf die folgenden populärwissenschaftlichen Ausführungen einlässt, wird sein eigenes Risikoverhalten beim Mountainbiken womöglich besser verstehen.

Mountainbiken zwischen Sicherheit und Risiko
Risiko wird gemeinhin als Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens multipliziert mit dessen Ausmaß verstanden. Skateboarder, die auf einem leeren Platz umherrollen tragen ein geringeres Risiko als beispielsweise Freikletterer an einer hochalpinen Wand. Auf einem Mountainbike-Trail steigt das Risiko mit Geschwindigkeit, Gefälle, Hindernissen und gefährlichen Sturzzonen. Jeder Biker schätzt das Risiko anders ein. Bedrohungs- und Sicherheitswahrnehmung sind subjektiv und situationsbedingte soziale Konstruktionen. Ausschlaggebend ist die Freiwilligkeit des Eingehens, die Kontrollierbarkeit und die Verantwortlichkeit für das Risiko. Sicherheits- und Risikobedürfnis gelten in der Soziologie als komplementäre Teile der menschlichen Grundkonfiguration. Individuen müssen sich alltäglich mit verschiedensten Risiken auseinandersetzen und entwickeln deshalb Routine- und Sicherheitsmaßnahmen. Die gesteigerte Wahrnehmung von Unsicherheiten, beispielsweise durch den entgrenzten Zugang zu Nachrichtenmeldungen und der Globalisierung von Herausforderungen, wie Handel oder Klima, führt zu einem gesteigerten Bedürfnis nach Sicherheit.

Trotzdem sind Menschen keine monokausalen Sicherheitswesen. Absolut gesetzte, abstrakte Sicherheit gilt als lustfeindlich. Routinen sind häufig für die in der Erlebnisgesellschaft gefürchtete Langeweile verantwortlich. Risikosport bietet durch den spaßorientierten Umgang mit Angst einen attraktiven Möglichkeitsraum für den lustvollen Umgang mit Unsicherheit. Risikosportarten beinhalten per Definition eine Abweichung von bestimmten Normen. Die immanenten Normabweichungen werden gerade von jungen Menschen oft als attraktiv wahrgenommen. Die Sportwissenschaft verwendet Begriffe wie Wagnis-, Fun-, Trend- und Risikosport oft synonym. Soziologisch lässt sich Risikosport definieren als das bewusste Eingehen sportlicher Risikosituationen mit dem Ziel der Bewährung durch aktiven Einsatz eigener Fähigkeiten. In Studien konnte herausgefunden werden, dass Risikosportler nicht nach dem Risiko an sich suchen, sondern ausschließlich nach einer kalkulierbaren Form. Risikosport und Vernunft sind demnach keine Widersprüche. Die meisten Mountainbiker prüfen beispielsweise regelmäßig ihr Material und schützen sich mit einem Helm sowie weiteren Protektoren.

Profi-Biker als moderne Gladiatoren
Prominente Vertreter der Phänomenologie verstehen den menschlichen Leib aus Einheit von Körper und Selbst. Gleich einem Besitz sei der Körper individuelle Darstellungsfläche der Identität und Medium der Selbsterfahrung. Für den menschlichen Selbstwert ist es relevant die Grenzen des leibkörperlichen Leistungs- und Belastungsvermögens zu kennen. Das freiwillige Erreichen und überschreiten solcher Grenzen führt wiederum zum Risikosport. Als Individualsportart beinhaltet Mountainbiken eine starke Betonung auf die Individualität der Subjekte. In Begierde, Schmerz und Anstrengung realisiert das Individuum seine eigene Leiblichkeit. Sieg oder Niederlage des eigenen Willens über die Leiblichkeit können positive oder negative Auswirkungen auf das Selbstverständnis nehmen. Erfolgreich bestandene Gefahrensituationen im Sport können eine große biographische Bedeutung haben und risikosportliche Körperkultur kann soziologisch als selbsttechnologische Subjektivierungspraktik verstanden werden.

Der Körper erfährt heute mehr Öffentlichkeit den je. Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts werden Sportler immer mehr in Szene gesetzt. In der modernen medialen Darstellung sind Risikosport-Athleten, wie etwa Promi-Biker, jedoch mehr als nur Sportler. Sie sind Vorbilder, prägen einen Lebensstil, liefern spektakuläre Bilder übermenschlicher Leistungsfähigkeit und sportiv gestylter Erotik. Natürlich besitzt die Rolle von prominenten Persönlichkeiten des Mountainbike-Sports auch ein ökonomisches Moment. Im Dienste ihrer Sponsoren kämpfen sie als moderne Gladiatoren um die Aufmerksamkeit der Masse. Der Mountainbike-Sport hat sein Dasein am Rande der öffentlichen Wahrnehmung längst hinter sich gelassen und gehört zu den Aushängeschildern so mancher Werbekampagne großer Marken.

Attraktivität des Risikosports
Modernisierung und Wohlstandstrend haben in Industriestaaten zu einer Vermehrung von sozialen und materiellen Sicherheiten geführt. Akute existentielle Probleme haben in Deutschland zum Glück nur noch wenige Menschen zu befürchten. Tatsächlich hat die Multioptions- und Erlebnisgesellschaft inzwischen einen Stand von Spannungsarmut erreicht, in dem immer weniger Erfahrungstiefen entstehen. In der arbeitsweltlichen Körperfeindlichkeit begeben sich Menschen verstärkt auf die lustvolle Suche nach tiefgehenden leiblichen Erfahrungen und Spannung. Sport bietet ihnen einen besonders attraktiven Raum für verlorengeglaubte Erlebniswelten. Der deutsche Soziologe Ulrich Beck prägte den Begriff der Risikogesellschaft. Er ging davon aus, dass soziale, ökologische, politische und individuelle Risiken zunehmend durch gesellschaftliche Entscheidungen, Technik, Industrie und Wissenschaft produziert werden. Diese systematisch produzierten Unsicherheiten seien nicht lokal begrenzbar und schwer kontrollierbar. Risiken beim Mountainbiken wiederum sind begrenzbar und kontrollierbar. Auch das könnte einen Erklärungsansatz dafür bieten, warum so viele Menschen ihr Unsicherheitsbedürfnis in diesem selbst gesteckten Rahmen befriedigen wollen.
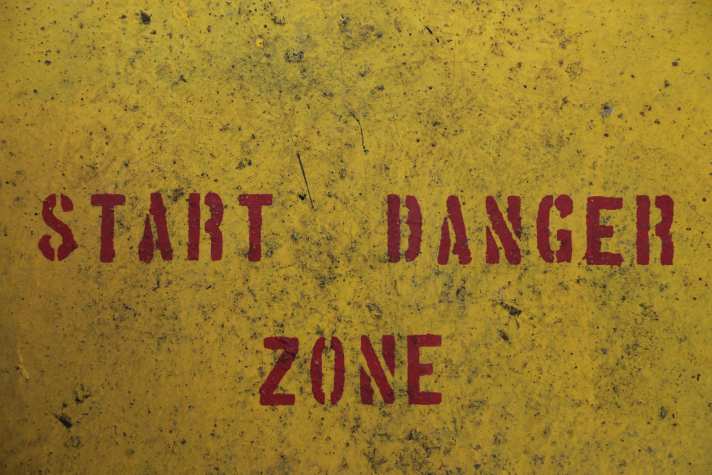
Risikosport erhält in einer Gesellschaft in der zunehmend administriert, reglementiert, ritualisiert, romantisiert und versichert wird einen festen Platz im alltäglichen Leben vieler Menschen. In kaum einer anderen Aktivität wird die Fähigkeit zur selbstproduzierten Erlebnisfähigkeit stärker betont. Sportwissenschaftler Dr. Arne Göring fasst zusammen: “Die Gesellschaft schafft mit ihrer Entwicklungslogik vom Risiko zu Gefahren zweiter Ordnung und der hieraus resultierenden gesteigerten Konstruktion von Sicherheit die eigentliche Grundlage für das Aufsuchen risikosportlicher Aktivitäten. Menschen, die im fähigkeitsabhängigen Risikosport ihr Unsicherheitsbedürfnis befriedigen, sind somit bestrebt, Sicherheit unter Ernstfallbedingungen selbst und aktiv herzustellen.”

Einschätzung von Jan Timmermann, BIKE-Redakteur, Erziehungswissenschaftler (MA), Sozialpädagoge (BA)
Das Mountainbike ist ein ausgezeichnetes Instrument um die Erfahrungsarmut und Sicherheitsorientierung des Alltags zu durchbrechen. Wir Biker lieben kalkulierbares Risiko. Als Risikosport bietet Mountainbiken attraktive Einschreibungsmechanismen für Selbsttechnologien. Der Diskurs um den Sport hat sich in der Erlebnis-, Ergebnis- und Risikogesellschaft stark ausgebreitet. Wer verstehen will, warum Events, wie Red Bull Rampage und Co., so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, findet in den Sozialwissenschaften erhellende Erklärungsansätze.


