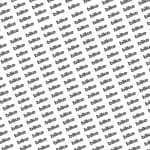Wenn abends die Sonne in der Namib untergeht, wird es still. Nur noch das gedämpfte Surren einer Fahrradkette und ein leichtes Atemgeräusch, unterbrochen von einem regelmäßigen Husten, dringt an mein Ohr. Wie ein Signal, eine Verabredung, die heißt: „Ich bin da“. Ein Blick zurück führt lediglich dazu, dass das Schwarz um mich herum für Sekunden noch schwärzer wird, wenn der grelle Lichtkegel einer Fahrradlampe die Pupillen trifft. Oder aber, wenn es verdächtig still ist und an meinem Hinterrad niemand mehr fährt. Stattdessen flackern in der Ferne kleine Lichter, wie Sterne am Himmel, die in dieser Nacht von einem Vollmond beschienen werden, der ab und an aus einer Wolkendecke hervorbricht.
Beim Blick nach vorn in die dunkle Nacht bleiben die Augen an roten Lichtern hängen, die wie auf einer Perlenschnur vor mir im Dunkel flackern und nur sehr langsam näherkommen. Romy und ich sitzen in diesem Moment bereits seit mehr als zehn Stunden im Sattel, auf unseren Mountainbikes, fest entschlossen, das Ziel beim „Platz am Meer“ zu erreichen. Ein Ziel, das bereits mehr als zehn Jahre auf meiner Bucketlist steht, bei den Dingen, die sportlich unbedingt einmal erlebt werden möchten.

An diesem 5. Dezember war es so weit: das berüchtigte Desert Dash Rennen in Namibia. 401 km durch die Wüste, 24 Stunden Zeit, das Ziel zu erreichen. Von der auf 1650 Metern Höhe gelegenen Hauptstadt Windhoek in einer wilden Hatz bis an den Atlantik nach Swakopmund. Man könnte meinen, immer nur den Berg hinunter und bis ans Meer zu rollen. Doch weit gefehlt. Knapp 4000 Höhenmeter warten auf der Strecke mit Namen wie US Pass, Kupferbergpass, Blutkuppe oder einfach die kurzen Rampen, die aus den zahllosen ausgetrockneten Flussläufen hinaufführen.
Ein Rennen, das im südlichen Windhoek in einer riesigen Tiefgarage des örtlichen Einkaufszentrums startet und anfangs durch karge Vegetation, später durch die Sandwüste bis ans Meer führt, gestaltet wie ein Drehbuch der Art Filme, in denen die Helden dem Traum folgen, einmal das Meer zu sehen und dabei Hindernisse überwinden müssen. So war auch unser Weg an die Startlinie des Dashs kein gewöhnlicher.
“Mountainbiker sucht Frau mit Leidenskraft”
Wir – das sind Romy Stotz (51) aus Moritzburg bei Dresden und ich, Markus Weinberg (42) aus Dresden. Wir haben uns zuvor noch nie getroffen, geschweige denn sind wir zusammen Rad gefahren. Für dieses Special Event habe ich in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet: „Mountainbiker sucht Frau: mit Leidenschaft und Leidenskraft – spontan, abenteuerlustig und aufgeschlossen.“ Schon der Aufruf war kurzfristig. Wer hat schon knapp drei Wochen vor einem 401 km langen Rennen sportliche Form und spontan Zeit, und dann sollte auch noch der Flug selbst bezahlt werden? Da musste schon einiges stimmen.

Fünf Bewerberinnen haben den Kontakt gesucht, doch Romy stach mit ihrem Anschreiben hervor. „Mein Name ist Romy, wir sind fast Nachbarn und meine größte Leidenschaft ist das Radfahren. Ich liebe das Draußensein bei Wind und Wetter, am Tag sowie in der Nacht, bin absolut leidensfähig und dennoch lächelnd dabei.“ Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste: Romy war gar keine Mountainbikerin. Allerdings 16 Jahre lang aktiv im Triathlon, hat Langdistanzen gewonnen und sich gleich zweimal den Traum von Hawaii erfüllt. Doch spätestens nach diesen Zeilen war ich überzeugt: “Ich möchte mein Leben füllen mit solchen Momenten, Erfahrungen, Abenteuern. Mal mutig sein und einfach machen. Ja!!! Das möchte ich.“ Ein Match.
Der Hinweis mit der benötigten Leidenskraft sollte im Verlauf auch noch eine Rolle spielen.
Ich selbst bin diesen Sommer 7000 km durch Europa geradelt und hatte an den 47 Tagen und 150 km täglich viel Zeit zum Nachdenken, was ich später zu Hause mit der Ausdauer anstellen kann. Vor allem: Wie verliere ich sie nicht gleich wieder oder beuge dem Winterspeck vor?
Indem ich mir Träume erfülle! Zuerst bin ich im Oktober die neue sächsische „RockHead“ Gravel-Strecke über 327 km am Stück gefahren und habe direkt im Anschluss den namibischen Dash-Veranstalter Leander um einen Startplatz gebeten. Eines jedoch musste dieses Mal anders sein. Diesen Traum wollte ich teilen. Nach Wochen allein auf dem Bike durch Europa war es Zeit für etwas Neues.
Am Tag vor dem Rennen, dem 4. Dezember, landeten Romy Stotz und ich in Windhoek, unter den Voraussetzungen, dass wir uns nicht kannten, keiner von uns beiden je 400 km auf einem MTB gesessen hat, ich zumindest noch nie mit einer Frau im Rennen gefahren bin und wir noch keine Räder hatten. Diese sollten wir von Timmo Großmann erhalten. Noch so ein Glück. Timmo ist Namibier, entstammt einer deutschstämmigen Familie, die in dritter Generation vor Ort in Windhoek lebt, und leitet ein Radgeschäft. Das Beste: Die ganze Familie sind radsportbegeisterte Desert-Dash-Fans von der ersten Austragung an und kümmern sich vor Ort mit um uns.
Die Meisten scheitern an Hitze, Wind und Wetter
Romy hat von Timmo ein Scott Spark geliehen bekommen, ich sein privates MTB. Das hat er sich aufgebaut und nach sechs Jahren in Dresden, inklusive Radmechaniker-Ausbildung, mit zurück in sein afrikanisches Zuhause gebracht. Sein Radgeschäft befindet sich nur 100 Meter entfernt von der Startlinie des Desert Dashs. „Auf jeden Fall würde ich euch bei der ersten Teilnahme Racefullys empfehlen“, betont Timmo und beschreibt uns die buckligen Sandpisten, bei denen die Arme ebenso viel zu tun bekommen wie die Beine. Einige Teilnehmer scheitern wohl nicht an der Fitness, sondern eher an den Bedingungen von Hitze, Wind und Wetter oder der Strecke, indem Hände, Arme, Schultern, Kopf eher aufgeben als die Beine.
Wir sind gespannt und stehen fast 24 Stunden nach der Landung in Windhoek mit circa 200 Gleichgesinnten der Solokategorie über die volle Distanz aufgeregt an der Startlinie. Vor uns auch der aktuelle MTB-Marathon-Europameister Andreas Seewald, der später, aussichtsreich im Rennen liegend, wegen Defekts ausscheiden wird. Romy und ich dagegen fahren das Rennen gemeinsam, auch wenn wir solo gewertet werden. Zum Glück geht es die ersten 32 Kilometer erst einmal gemächlich auf dem neu asphaltierten Abschnitt aus der Stadt. Zeit für Romy und mich, uns etwas zu finden, eine Gruppe zu suchen, die unserem Tempo entspricht, und die Kommunikation abzusprechen.

Am Kupferbergpass sind die Karten gemischt und ich erstaunt, dass kurz nach Beginn des Schotters fast jeder solo fährt, jede Gruppe direkt auseinander fällt. Ich denke mir: „Na super, jetzt 370 km von vorn im Wind.“ Das hatte ich mir anders vorgestellt, und ich bekomme es etwas mit der Angst zu tun. Mein Blick fällt auf Romy. Wir dürfen nicht überziehen, müssen nun sehr früh ein eigenes Tempo finden – wir wollen unbedingt finishen und das Rennen dabei auch genießen.
Bis zur Halbzeit haben sich schon ganz andere Sportler kaputtgefahren, wurde uns erzählt, denn da lauern zumindest die meisten der knapp 4000 Höhenmeter. Spätestens alle 40 km gibt es einen Wasserpunkt, den wir jedes Mal ansteuern, für einen Snack und um die Flasche zu füllen, die ergänzend zum Wasserrucksack am Fahrrad steckt. Ein Erlebnis für sich, durch die Feierstimmung und den anfeuernden Applaus der Verpflegungsteams. Nach dem US-Pass bei circa 80 Kilometern folgen die „12 Apostel“ genannten, zahnigen Anstiege vor dem ersten Checkpoint. Ich neige dazu, auf dem Gas stehen zu bleiben, und fahre zu schnell in die Wellen, ein kräftezehrender Ziehharmonika-Effekt entsteht.
Romy bleibt nichts anderes übrig, als auf sich zu hören und ihr Tempo zu finden. Ich verliere selbst eine Schraube an meinen montierten Aufliegern. Als ich mich umschaue, stürzt Romy in den Sand des Kuiseb Rivers am ersten Checkpoint nach 98 Kilometern. Wir sind ein wenig bedient. Nehmen uns die Zeit zum Trinken, Essen, Reparieren und zum kurz Durchatmen. Die gute Stimmung am Checkpoint hilft, von dem aus die 4er-Teams, und nach der Hälfte die 2er-Teams, ihre Fahrer tauschen und auf die Strecke schicken. Das Besondere daran: Nach Checkpoint 4 müssen alle Teamfahrer die letzten 50 Kilometer gemeinsam ins Ziel fahren.

Als wir wieder auf dem Rad sitzen, wird es bereits dämmrig. Feuerrot geht die Sonne am Horizont in der mit spitzen Bergkuppen versehenen Hügellandschaft unter. Der Himmel brennt, die Radlichter leuchten auf und es kehrt eine äußere und innere Ruhe ein, nur unterbrochen von den Pickup Trucks der Teamfahrzeuge, die auf diesem Abschnitt oft etwas zu schnell an uns, Staub aufwirbelnd, vorbeiziehen. Romy und ich beginnen, uns zu finden. Ein Tempo zu entwickeln, das hält, von dem man glaubt, man könnte es ewig so weiterfahren. Wir fahren uns in eine Art Trance.
Romys beginnender Husten wird zu meinem Signal, dass sie noch da ist. Anders kann ich sie in der Dunkelheit kaum identifizieren. Die Wasserpunkte ziehen vorbei. Halbzeit – ohne große Probleme. Wir ruhen ein paar Minuten auf den Sitzkissen aus, treffen unser eigenes Begleitfahrzeug und essen ausgiebig. Pünktlich um Mitternacht starten wir hinter den Half-Dash-Fahrern in die zweite Hälfte der Nacht und des Rennens und müssen gefühlt einen 15 Kilometer langen, leicht ansteigenden Hügel hinauf, mit den ersten schwer zu befahrenden Sandpassagen. Wir kommen erstaunlich gut durch.
Verdammt, falschen Schaltungs-Akku eingesteckt...
Wir überholen Fahrer um Fahrer, bis auf einmal bei Romy die Schaltung ausfällt. Falscher Akku an der Schaltung eingesteckt. Shit. Ich fluche kurz herum, und nach etwas Sauerstoff im Kopf schaltet der Verstand auch wieder ein. Ich gebe ihr meinen Akku und fahre die nächsten 25 Kilometer Singlespeed zu Checkpoint 3. Blutkuppe heißt der Ort, dessen Gestein am Tag rötlich scheint. Wir sehen zwar nur Schwarz, finden aber am Checkpoint ein Ladegerät und nehmen uns 20 Minuten. Zum Aufladen der körperlichen und mechanischen Akkus.

Herausfordernd sind die Sandabschnitte in der Dunkelheit, die an zwei Punkten vom Veranstalter mit einer Art Steg versehen wurden, damit sie passierbar sind. Ab und an holt es aber jeden vom Rad. Auch uns. Im Sonnenaufgang fällt die Temperatur von angenehmen 20 Grad auf 12, während wir einen 15 Kilometer langen Abschnitt entlang einer Pipeline in Angriff nehmen. Immer wieder rollen wir einzelne Fahrer auf, auch Solostarter, die wir 200 Kilometer zuvor zum letzten Mal gesehen haben. Ein gutes Zeichen.
Wir rollen konstant, auch wenn ich mit der Müdigkeit kämpfe und mir ständig die Augen zufallen. Ich habe Angst, vom Rad zu fallen. Zum Glück kommt der letzte große Checkpoint in einer Art Wüstenoase: Goanikontes und ein halber Liter Cola. Wir sind Stunden vor dem Cut-off am Checkpoint, nur unser Versorgungsteam ist eingeschlafen und muss erst einmal von uns geweckt werden. Schnell sitzen wir wieder im Sattel, und um uns herum nun viele 4er-Teams in Mannschaftsstärke. Die vorher etwas trostlose Mondlandschaft wandelt sich zu spektakulär.
Unsere Stimmung ist in Vorfreude auf das Ziel, als es passiert! An einer etwas größeren Welle des wie eine Art Wellblech oder Waschbrett ausgefahrenen Weges knallt es Romy den Lenker weg. Schock. Ich denke, das war’s – so kurz vor dem Ziel. Von ihr nur ein: „Nichts passiert.“ Während das Blut von Arm und Bein läuft. Ohne sich anzuschauen, schwingt sie sich zurück aufs Rad und wir rollen die letzten 20 Kilometer nach Swakopmund an den Atlantik. Die letzten Meter sind überwältigend. Tränen der Freude steigen auf.

Noch nie zuvor haben wir so eine Strecke absolviert, schon gar nicht gemeinsam. Nach 21:20:36 Stunden rollen wir über die Ziellinie am Einkaufszentrum „Platz am Meer“. Müde, geschafft, mit Blessuren versehen – aber glücklich.
Namibia - das muss man wissen
Deutschland hat eine wechselhafte Beziehung zu Namibia. Von 1884 bis 1915 war das Land eine deutsche Kolonie, in der die Deutschen Völkermord an den Herero und Nama begingen. Heute haben noch etwa 1 Prozent der Bevölkerung, rund 30.000 Einwohner, einen deutschen Hintergrund, wodurch Deutschland das Land auch heute noch prägt. Deutsche Namen finden sich in Städten, Straßen, Orten und Geschäften. Viele Farmen befinden sich im Besitz deutschstämmiger Familien und sind damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor des Landes. Zwei Drittel des Landes bestehen aus Wüste: die Namib an der Küste und die Kalahari im Osten. In dem am zweitniedrigsten besiedelten Land lebt bis heute eine vielfältige Tierwelt. Die Big Five: Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn, Büffel. Und die Little Five Namibias: Palmato-Gecko, Weiße Dame (Radspinne), Namaqua-Wüstenchamäleon, Sidewinder-Schlange, Wüsteneidechse.
Rekord-Teilnehmerin

Monika Großmann hat an allen 21 Ausgaben des Rennens in unterschiedlichen Kategorien teilgenommen: 5x Solo, 8x im 2er-Team, im Half Dash usw. Sie ist in Namibia geboren und auf einer Farm aufgewachsen, nachdem ihre Eltern – aus Breslau und Thüringen stammend – nach dem Krieg nach Namibia ausgewandert waren. Ihren Mann Kai aus Dresden hat sie Anfang der 90er Jahre im Schwarzwald kennengelernt und er folgte ihr nach Namibia, wo 1999 ihre Zwillinge Timmo und Steffie zur Welt kamen. Sie teilen die Leidenschaft zum Mountainbiken und standen seit der ersten Ausgabe 2005 als Familie am Start des Desert Dash.
Mountainbiken in Namibia
Anders als in Südafrika gibt es nur wenig gebaute Strecken und Bikeparks, dafür tausende Kilometer lange Schotterpisten durchs Land, da nur wenige Hauptstraßen asphaltiert sind. Wegenetze abseits der öffentlichen Straßen führen im Inland oft über Farmland und müssen lokal abgestimmt werden, ob eine Durchfahrt möglich ist.
- Trailnetze gibt es vor allem im Khomas Hochland um die Hauptstadt Windhoek herum, auf 1650 Metern Höhe gelegen: Die IJG Trails auf Farm Windhoek locken mit über 100 km Trails in den Auas-Bergen in unmittelbarer Nähe südlich der Hauptstadt. Info: ijgtrails.com
- Die Towerbows Trails, 15 Kilometer westlich der Hauptstadt, bieten ein Netzwerk aus 31 km langen Trail Loops. Ideal für Tagesausflüge aus der Stadt. Infos: towerbos.com
- Trail-Netzwerke befinden sich auch in Swakopmund am Atlantik oder bei Omaruru auf der Loskop. Übersicht: trailforks.com
Zum Teil bieten aber auch Farmen im Land ihre Wegnetze zum Biken an, inklusive Übernachtungen in Lodges. z. B.:
Farm Donkerhuk, donkerhuk.com
Farm Godeis: godeis.com
Farm Nauams: nauams.com
Geführte Touren in Namibia: mountainbikenamibia.com
Das nächste Desert Dash 2026
Mit über 1000 Teilnehmern war das Rennen dieses Jahr voll ausgebucht. Es gibt Solo-Startplätze über die volle Distanz aber auch 2er- und 4er-Teams, die sich die Strecke von 401 Kilometern in 24 Stunden aufteilen. Termin für 2026: 11. Dezember. Info: desertdashnamibia.com