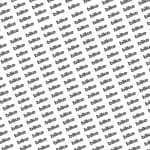Der Kili ist wie Abi: Man bereitet sich lange darauf vor. Geht jedes Detail wieder und wieder durch. Überlegt: was wäre, wenn? Trainiert jede freie Minute daraufhin. Und dann? Null Euphorie. Dafür Kopfschmerzen. 5895 Meter Höhe fühlen sich also an wie ein verdammter Gin-Tonic-Kater?! Weder Hirn noch Beine sind fähig, in den dritten Gang hochzuschalten. Jede Bewegung passiert wie in Zeitlupe. Nur zäh dringt die Außenwelt in mein Wahrnehmungszentrum ein: Hier oben, auf dem staubigen Plateau des Uhuru Peaks tummeln sich Menschenscharen. Überall Schulterklopfen, Umarmungen, es werden Beweisfotos gemacht. Ich schaffe es nicht, die Bergsteiger in Wanderstiefeln zu zählen, aber ich weiß: wir sind sieben Mountainbiker. In den Alpen würde an dieser Stelle ein Kreuz den Höhepunkt markieren. Hier oben stehen wir vor einer Art Holzbretterwand, die über sämtliche Superlative des Berges informiert: „Africa’s highest point“, „World’s highest freestanding mountain“, „One of the world’s largest vulcanoes“. Klingt alles prima. Was fehlt, ist die Euphorie.

Ein Jahr zuvor rief Lukas an: „Rate mal, auf welchem Gipfel ich grad stehe!“, wollte mein Schweizer Bike-Spezi Lukas Stöckli wissen. Keine Ahnung – Großer Arber, Zugspitze, Matterhorn? „Nein, auf dem Kilimanjaro! So geil hier oben, nächstes Jahr musst du unbedingt mitkommen!“ Für mehr reichte die Luft damals nicht. Doch seine wenigen Worte hallten in mir nach. Auf den höchsten Berg Afrikas wollte ich auch schon immer mal. Doch lange Zeit hieß es, dafür bekäme man mit dem Bike keine Genehmigung. Dass diese Regelung geändert wurde, muss ich dann wohl verschlafen haben. Ich googlte mich durch Tourenberichte von Wanderern, versuchte die beschriebenen Aufstiegswege in Kettenblatt-Umdrehungen und eventuell schmerzhafte Tragepassagen zu übersetzen. Ich träumte von Übernachtungen unterm afrikanischen Sternenhimmel. Sprich: Ich kannte diesen Berg, lange bevor er mich kennen lernte. Mein Anruf bei Lukas war da nur noch eine Formsache: „Alles klar, Luki, ich komme das nächste Mal mit. Ich schenke mir die Kili-Tour zum 50. Geburtstag!“
Die wohl längste MTB-Abfahrt auf diesem Planeten
Seit fünf Jahren dürfen auch Mountainbiker Afrikas höchsten Berg, einen der „Seven Summits“, erklimmen. Es ist ein alleinstehender Klotz, der unvermittelt aus der Steppe Tansanias wächst und noch immer eine Frisur aus weißem Gletschereis trägt. Für Biker ist sein Gipfel das höchste Ziel der Welt und die Abfahrt entsprechend die längst mögliche auf diesem Planeten: also von 5895 auf 1400 Meter in einem Rutsch bergab. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann man sich selbst nicht machen. Damit ich nicht allein am Berg feiern muss, habe ich mich Bikeguide Luki und seiner Biker-Gruppe angeschlossen.

Mit von der Partie sind: Ueli, ein Bikeguide aus der Schweiz, Roman, der aussieht, als könne er Stahlrohre biegen, Rebecca aus dem Pott, Bike-Bergsteigerin Esther und Dani, ein Banker aus Liechtenstein. Unser Guide-Chef am Berg heißt Richard. Ein Massai, der seit vielen Jahren Touristen auf den Kili führt und inzwischen auch jedes Jahr eine Handvoll Bergradler. Doch Richard guided uns nicht allein. Für unsere siebenköpfige Gruppe hat er 40 Träger engagiert.
Der Trick ist: Nicht so schnell wie möglich, sondern so langsam wie möglich Höhe zu machen – sonst schafft man den Gipfel nicht. - Richard, unser Chef-Guide am Kilimanjaro
Sechs Tage lang nur bergauf. Zugegeben: Anfangs fühlte ich mich mies, dass die Einheimischen für uns Zelt, Abendgarderobe, ein garagengroßes Gruppenzelt und zwei Toilettenzelte (inklusive Chemiesitzklo), sowie Essen und Trinken für eine Woche den Berg hochschleppen, während an unseren Schultern gerade mal ein halbgefüllter 16-Liter-Rucksack hoppelt. Doch am zweiten Tag wird mir klar: Wer am Kili arbeitet, verdient gutes Geld. In einer Woche so viel, dass eine vielköpfige Familie einen Monat lang davon leben kann. Dieser Berg ist also viel mehr, als der größte Klotz in Afrika. Er ist Arbeitgeber für Hunderte von Menschen.

Unser erstes großes Zwischenziel ist die Kibo-Hütte auf 4700 Meter Höhe. Und die erreichen wir auf der neuen Rescue Road. Auf der geschotterten, an Steilrampen sogar betonierten Rettungsstraße kann man fast alles fahren. Auch wenn die Rampen mit zunehmender Höhe und spürbar dünner werdender Luft alles andere als Spaß machen. Leider ist die Kibo-Hütte für verweichlichte Westler eher unbewohnbar. Mit ein Grund, warum Richard für jeden seiner Gäste ein eigenes Zelt hier hochtragen lässt. „Zwischen 80 und 90 Prozent erreichen die Hütte fahrenderweise“, erzählt Luki. Dank Richards ausgeklügelter Logistik und Akklimatisationstaktik schaffen es die meisten dann auch bis ganz oben. „Pole, pole!“, hören wir unseren Chef-Guide während der sechstägigen Auffahrt immer wieder rufen. Denn nur wer langsam, langsam macht, hat am Kili eine reelle Gipfelchance. Von den 30.000 Wanderern im Jahr, die oft deutlich schneller hier hoch hetzen, schafft es dagegen scheinbar nur ein Drittel bis ganz nach oben.

Der Körper braucht eben Zeit, um sich an den Druck anzupassen und der ist am Gipfel des Kilimanjaro nur noch halb so hoch wie auf Meereshöhe. Der Trick ist: Nicht so schnell wie möglich, sondern so langsam wie möglich Höhe zu machen.
Auf Lukis Rat hin habe ich mir sogar ein 28er-Kettenblatt montiert, das schon fast zum Schneckengang zwingt. Dazu hat Richard extra einen Umweg für uns eingebaut. So kommen wir den vielen Wanderern nicht in die Quere und verbringen auf 4400 Meter Höhe noch mal eine Extra-Nacht im Zelt. Kopfschmerzen flackern zwar immer mal kurz auf, aber der Erschöpfungsgrad hält sich in Grenzen. So geht es auch den anderen, als wir schließlich alle die surreale Gipfelwelt erreichen. Fünf Kilometer über der afrikanischen Steppe mit der 200.000-Einwohner-Stadt Moshi, wo wir vor sechs Tagen gestartet sind. Allerdings blicken wir nach unten auf ein Meer aus Wolken. Geradeaus auf den gigantischen Gipfelkrater des Vulkanbergs. Auch das Southern Icefield liegt zum Greifen nah. Der dreißig Meter hohe und mehrere hundert Meter lange Gletscherwürfel auf schwarzem Lavasand trotzt hier noch immer dem Klimawandel.
Der Aufstieg zum Kilimanjaro: 6 Tage - die Abfahrt: 6 Stunden
In meinem Kopf tobt nun aber der Gin-Tonic-Kater und ich bin froh, dass wir nach einer halben Stunde den Weg nach unten antreten. Schließlich ist am Gipfel erst die Hälfte der Strecke geschafft. Wanderer brauchen für den Abstieg zwei Tage, Mountainbiker sechs Stunden. Vom „Uhuru Peak“ geht's auf flacher, pechschwarzer Lavapiste ziemlich atemlos zum Kraterrand am Gilman‘s Point und von dort auf ruppigen Kehren hinunter zur Kibo-Hütte. Bis auf 100 Tiefenmeter alles fahrbar, aber es sind die staubigsten 1200 Tiefenmeter, die ich je erlebt habe. Unsere Träger und Köche erwarten uns an der Kibo-Hütte mit Applaus, Pancakes und Porridge.

Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Sandfahnen hinter uns herziehend, fliegen wir die restlichen 3300 Tiefenmeter nach Marangu in einem Rutsch hinunter. Knapp unterhalb des ersten Camps im Dschungel haben die Einheimischen sogar extra einen zehn Kilometer langen Singletrail für Biker um die Bäume verlegt. Nach der längsten Abfahrt meines Lebens, durch alle Klimazonen Afrikas, erreichen wir um zwei Uhr mittags das laute, bunte Marangu. Jetzt spüre ich die Euphorie – sie sprudelt durch sämtliche Nervenbahnen!
Infos zum Kilimanjaro

Der Berg
Der Kilimanjaro ist ein freistehendes Bergmassiv nahe der Grenze zwischen Tansania und Kenia. Sein 5895 Meter hoher Gipfel besteht aus drei Vulkankratern und einem schwindenden Gletscherfeld. Vor vielen Jahren bereits von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, war eine Befahrung mit dem Mountainbike lange Zeit verboten. Doch seit ein paar Jahren dürfen auch Biker Afrikas höchsten Gipfel in Angriff nehmen.
Die Tour: gesamt 160 km und 7600 hm
Die Route ist im Prinzip nicht schwierig, aber es geht in große Höhen. Eine gute Kondition ist wichtig, aber entscheidend für das Erreichen des Gipfels ist eine gute Akklimatisation.
Die Auffahrt dauert daher insgesamt sechs Tage: Dank der Topografie des Berges und der breiten Rescue Road kann man auf der „Kilema-Route“ von Marangu (1420 m) bis zur Kibo-Hütte (4700 m) bis zu 90 Prozent fahren. Nach den unfahrbaren 1000 Höhenmetern zum Kraterrand am Gilman’s Point (5681 m) können starke (und gut akklimatisierte) Biker bis ganz hoch zum Uhuru Peak (5895 m) kurbeln.
Die Etappen
- Tag 1: Marangu (1420 m) – Dschungel-Camp (2900 m):
21 km/1500 hm - Tag 2: Dschungel-Camp – Horombo-Hütte (3700 m):
6 km/850 hm - Tag 3: Horombo-Hütte – Zebra Rocks (4000 m) – Horombo-Hütte:
5 km/350 hm - Tag 4: Horombo-Hütte – Mawenzi-Camp (4400 m):
15 km/1000 hm - Tag 5: Mawenzi-Camp – Kibo-Hütte (4700 m) – Hans Meyer Cave (5220 m) – Kibo-Hütte: 12 km/1000 hm
- Tag 6: Kibo-Hütte – Uhuru Peak (5895 m) – Marangu (1420 m):
48km/1250 hm/4500 tm
Die Abfahrt: Die 48-Kilometer lange Abfahrt ist, mit Ausnahme eines unfahrbaren Felsriegels ( ca. 100 Tiefenmeter) einfach und flowig. Vom Gilman’s Point zur Kibo-Hütte warten steile, weite Schotterkehren (S2), danach geht’s flach über das riesige Hochplateau zur Horombo-Hütte (S1). Ab hier fliegt man auf angelegten (!) Dschungel-Trails (S2) und schnellem Schotter endlos lange hinab nach Marangu.
Guiding
Individuelle Mountainbike-Touren sind im Nationalpark noch immer verboten. Geführte Touren bieten inzwischen aber einige europäische Veranstalter an. Wir haben die Tour mit dem ehemaligen Worldcup-Rennfahrer und Schweizer Bikeguide Lukas Stöckli gemacht. Er bietet den höchsten Bike-Berg mit der längsten Abfahrt der Welt seit mittlerweile vier Jahren als geführte Tour an.
Für den nächsten Termin muss man allerdings schnell sein: 29.9.-9.10. 2024.
Preis inkl. Zeltübernachtung, Guiding und Vollpension: 5490 Euro, Flug extra.
Weitere Infos und Anmeldung: lukasstoeckli.ch