





Robert Mennen kneift herzhaft in den Schulterstollen eines „Magic Mary“-Vorderreifens und verdreht ihn um zwanzig, dreißig Grad. Er konzentriert sich und löst schlagartig seinen Griff: Fast sofort richtet sich das Gummi wieder gerade aus – aber eben nur fast sofort. „Das ist der einfachste Test überhaupt“, sagt er. „Je langsamer der Stollen sich zurückdreht, desto stärker dämpft der Gummi.“ Ein sehr, sehr feines Thermometer würde registrieren, dass der Stollen durch die Drehung und Rückstellung wärmer geworden ist. Die mechanische Energie aus Roberts Fingern hat sich in Wärme verwandelt.
Tritt man einen Schritt vom winzigen Stollen zurück, weitet sich der Blick auf eines der Grunddilemmata der Reifentechnik. Beim verdrehten Stollen geht es nämlich um Dämpfung versus Rollwiderstand: Je besser gedämpft und damit kontrollierter sich der Reifen benimmt, desto mehr Antriebskraft wird zu Wärme. Das steigert den Rollwiderstand. Oder grobe Stollen, die den Boden verformen: Toller Grip, aber schon wieder diese klitzekleine, kraftraubende Mikrowärme ... Was bergab Spaß bringt, saugt bergauf Akku und Muskulatur leer.
Und das sind nur zwei der vielen Optimierungsprobleme im Reifendesign. Mennen, ehemaliger Cape-Epic-Sieger, ist heute Produktmanager für Mountainbikereifen bei Schwalbe. Sein Job ist es, die Widersprüche zwischen den vier Zielen Grip, Dämpfung, Pannenschutz und Verschleiß so auszutarieren, dass jede Bikerin und jeder Biker im Schwalbe-Sortiment den persönlichen Lieblingsreifen für die persönliche Lieblingsstrecke findet – was in der gigantischen Produktvielfalt von über 300 Reifenmodellen mündet.
Abgesehen von der Reifengröße und -breite variieren die Reifenentwickler aller Marken vor allem drei Parameter: Karkassenaufbau, Profil und Gummimischung. „Eigentlich denke ich, dass wir alle sinnvollen Varianten eines Modells anbieten“, sagt Mennen, „und trotzdem kommen manchmal Leute, die wollen Reifenmodell A mit der Karkasse B und dem Compound C.“

Die Entwicklung eines neuen Reifenmodells kostet schon auf der Hardware-Seite einen sechsstelligen Betrag. Vulkanisierformen und Maschinenteile sind kostspielig, also darf nichts schiefgehen. In der Schwalbe-Zentrale im Bergischen Land haben sie deshalb ein riesiges Testlabor errichtet. Robert Mennen benennt die einzelnen Apparaturen. Es sind Prüfstände für Dehnfestigkeit. Absprungsicherheit, Ozonbeständigkeit, Verschleiß in Kurvenlage, Rollwiderstand, Durchschlag- und Durchstichfestigkeit, Bremsgrip und so weiter. Fotos sind nicht erlaubt. Doch spannender als die Aquarien voller Aluprofile, Elektromotoren und Displays ist ohnehin das Wissen, das in die Versuche einfließt und aus ihnen entsteht.
Mennens Kollege Lars Funke trägt im Labor zwei massive Alu-Laufräder mit Rennradreifen zu einer Prüfmaschine. Die fast profillosen Rennradreifen bergen ein Geheimnis: Eine neue Mountainbike-Gummimischung steht vor dem Labortest. „Neuen Compound vulkanisieren wir für die Labortests zuerst auf Rennreifen“, erklärt Robert Mennen. „Weil die kein Profil haben, können wir sicher sein, dass Unterschiede in Grip, Rollwiderstand oder Verschleiß sich aus dem Gummi erklären.“
Tubeless war ein echter Meilenstein. Das hat gleichzeitig die Pannensicherheit, den Rollwiderstand und – durch den möglichen niedrigen Druck – den Grip verbessert. Seitdem haben sich die Reifen natürlich ständig weiterentwickelt. Aber eher in kleinen Schritten. – Robert Mennen, Schwalbe
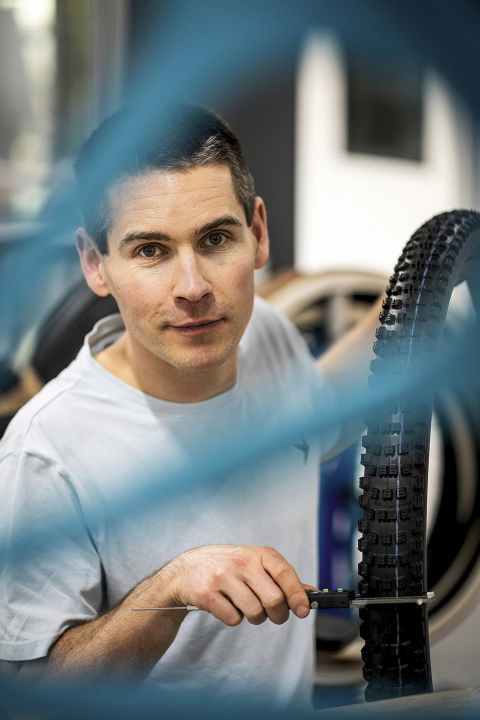
Über einhundert verschiedene Zutaten stecken in einem Compound. Naturlatex, synthetisches Latex, Öle, Farb- und Füllstoffe. Und obwohl bereits seit 1839 Gummireifen vulkanisiert werden, geht die Entwicklung immer weiter. Der Füllstoffe Silica ist beispielsweise erst seit gut zwei Jahrzehnten im Einsatz. In der richtigen Dosierung verbessert er den Nässegrip und senkt gleichzeitig den Rollwiderstand, bei geringem Verschleiß – drei Parameter, die mit den bis dahin üblichen Gummirezepturen deutlich schlechter vereinbar waren. Auch mit neuestem Compound besteht ein Optimierungsproblem zwischen den drei Zielen Haftung, Rollwiderstand und Verschleiß. Aber eben auf höherem Niveau. Eine vierte Anforderung ist der Umweltaspekt: Reifen verschleißen beim Fahren. Sie streuen Feinstaub und Mikroplastik in die Landschaft. Der Autoclub ADAC hat in Versuchen ermittelt, dass ein Pkw auf 1000 Kilometer durchschnittlich 120 Gramm Abrieb hinterlässt. Beim Mountainbike dürfte es, in sportlichen Trail-Kilometern gerechnet, nicht weniger sein.

Schwalbes Nachhaltigkeitsteam sieht sich als Vorreiter der Branche. Das selbst gesetzte Ziel ist es, „den Umwelteinfluss durch Optimierung der Gummimischungen sukzessive zu verringern. Wir möchten sicherstellen, dass der Reifenabrieb für die Umwelt nicht schädlich ist“ – natürlich, ohne dass die Performance leidet, wie Produktmanager Mennen ergänzt: „Was nützt ein Reifen, der sich anfühlt, als würde man in einem Sack Nüsse fahren?“
Der Compound ist nur für einen Teil der Fahrleistung zuständig. Von Schwalbe, Continental und Maxxis kommt übereinstimmend die Ansicht, dass die richtige Gummimischung etwa ein Drittel zur Performance beiträgt. Aaron Chamberlain, der zuständige Produktmanager bei Maxxis in den USA, fasst die Aufgaben der Bestandteile kompakt zusammen: „Der Compound beeinflusst den Grip, die Karkasse bestimmt Pannenschutz und Rollwiderstand, das Profildesign wirkt sich vor allem auf Handling und Rollwiderstand aus.“

Spurenlesen: Welchen Unterschied machen die Stollen am Fahrradreifen wirklich?
Warum sehen die Profile so aus, wie sie aussehen? Am Beispiel von Schwalbes Enduro-Klassiker „Magic Mary“ wird klar, welche Überlegungen ins Reifenprofil einfließen. Die Enduro-Reifen der Mitbewerber ähneln diesem Design nicht zufällig.
Dass die Stollen kantig (und nicht etwa oval) sind, verschafft ihnen viel Kantenlänge und damit Grip quer zur jeweiligen Belastungsrichtung. Der Durchmesser der Stollen hängt mit ihrer Höhe zusammen. Hohe Stollen generieren in weichem Boden viel Grip, doch insbesondere auf festem Untergrund führen sie durch ihr Verbiegen zu einem schwammigen Fahrgefühl. Große Grundfläche stabilisiert sie. Der Nachteil: Große Stollen versteifen den Reifen insgesamt und erhöhen so den Rollwiderstand. Bestehen sie aus weichem, griffigem Compound, bewirkt dessen interne Reibung dasselbe. Dual Compounds mit härterer Innenschicht sind eine mögliche Gegenmaßnahme.
Besonders markant sind die Schulterstollen. Beim „Magic Mary“ sind sie leicht schräg angeordnet, beim Einsatz als Vorderreifen in der Draufsicht pfeilförmig in Fahrtrichtung. Im Bodenkontakt stehen sie dann v-förmig auf. So werden sie in der (tendenziell steifen) Längsrichtung belastet, wenn der Fahrer einlenkt und gleichzeitig bremst. Stünden sie andersherum, würde diese Kraft sie in der schmaleren Querrichtung verbiegen – ein wichtiges Argument für die richtungsgebundene Montage.

Die Mittelstollen treten in diesem Reifensegment fast immer in Zweier- oder Dreiergruppen auf. Sie bilden damit einen Querriegel mit hoher Bremskraft, ohne die Karkasse auf der Lauffläche unnötig zu versteifen. Mehr und kleinere Stollen finden sich tendenziell auf Crosscountry-Reifen mit weniger Profiltiefe. Die Mittelstollen sind mit kleinen Rampen an der (in Draufsicht) Vorderseite gegen die Bremsbelastung versteift, was zugleich den Rollwiderstand senken soll.
Kleine Schlitze in der Oberseite der Stollen, sogenannte Grooves, sollen die ersten paar Millimeter des Profils geschmeidiger machen, ohne die Gesamtsteifigkeit stark zu beeinträchtigen.
Das Design der Lauffläche zielt nach Aussagen aller Gesprächspartner ganz überwiegend auf bestmögliche Performance im jeweiligen Einsatzgebiet. Um die (technisch oft sinnvolle) Kombination verschiedener Reifen an Vorder- und Hinterrad ästhetisch zu verbessern, achten die Hersteller jedoch in Kleinigkeiten auch auf einen durchgängigen Marken-Look.
Spezialreifen fürs E-MTB?
Spezielle Reifen für E-Mountainbikes sind im Sortiment der großen Anbieter kaum zu finden. Schwalbes Modell „Eddy Current“ ist eine Ausnahme – und zeigt, wohin die Reise geht: Der Reifen ist breit und relativ schwer, aber auf Robustheit ausgelegt. Trotzdem sagt Produktmanager Robert Mennen: „Wir haben jetzt schon über 300 Reifenmodelle. Und es ist nicht sinnvoll, diese noch einmal in einer ,E-Version‘ aufzulegen. Ein Reifen fürs E-MTB braucht vor allem eine besonders pannensichere, robuste Karkasse. Die haben wir ohnehin im Programm.“ Performanceorientierte Reifen fürs Gelände bieten auch Maxxis oder Continental nicht in einer speziellen E-Version an. Continental-Mann Alexander Hänke sieht ähnliche Unterschiede wie sein Schwalbe-Kollege: „Am Hinterrad eines muskelgetriebenen Bikes musste man sich wenig Gedanken um die Uphill-Traktion machen.
Doch die ist jetzt ein Thema. Um das Drehmoment der starken E-MTBs auf den Boden zu bringen, kann man am Profil und an der Breite arbeiten. Nach unseren Fahrtests sind die vorhandenen Modelle in einer großen Breite dem aber gewachsen. Da braucht es also kein neues Profildesign. Der zweite Punkt ist die typischerweise weniger agile Spurwahl mit einem langen, schweren Bike. Um Durchschläge und andere Schäden zu vermeiden, empfehlen wir deshalb immer die nächstrobustere Karkasse, beispielsweise eine Enduro-Karkasse für ein Trailbike.“ Kurz gesagt: Wenn der Reifen eine Klasse breiter, robuster und grober profiliert ist als bei einem ähnlich ausgelegten Muskel-Fahrwerk, sollte er am E-MTB perfekt funktionieren.

Ähnlich wie der Compound muss sich die Karkasse, also die tragende Textilkonstruktion im Reifeninneren, in verschiedene Richtungen strecken. Idealerweise wäre sie geschmeidig wie ein Seidenschal, stichfest wie eine Schutzweste und robust wie Kampfhundespielzeug. Keine Überraschung: Das geht nicht. Viele dünne, eng liegende Fäden (also ein hoher TPI-Wert) sind geschmeidig und halbwegs stichsicher, aber nicht besonders schnittfest oder durchschlagsicher. Sie eignen sich für muskelgetriebene Crosscountry-Bikes. Für mehr Sicherheit addieren die Hersteller mehrere Schichten oder zusätzliche Materialien unter der Lauffläche und im Bereich nahe der Felge. Scharfe Steine, spitze Dornen und übersehene Kanten haben dann weniger Chancen, den Fahrer tieferzulegen. Übertreibt man es mit der Sicherheit, rollt so eine Karkasse aber zäh und holprig wie eine überlagerte Lakritzschnecke. Das macht auch mit Motor wenig Spaß.
Nicht von ungefähr haben die großen Reifenhersteller im oberen Preissegment mindestens drei verschieden robuste Karkassen im Angebot. Zwischen „leicht, schnell, sensibel“ und „steif, aber kugelsicher“ liegen Welten im Rollwiderstand und Fahrverhalten. Und spätestens hier kommt der Punkt der Reifenentwicklung, an dem das Material jenseits der Labortüren auf die Wirklichkeit trifft. Wenn die Basics im Labor ausgereift sind, beginnt eine lange und systematische Praxisphase. Maxxis-Mann Aaron Chamberlain zieht einen Strich drunter: „Für Dinge wie Materialentwicklung und Qualitätssicherung sind Labortests nützlich. Aber darüber hinaus lernt man nicht viel von einer Stahlwalze.“
Reifentesten in der Praxis: Athleten, Mitarbeiter und ambitionierte Laien mit Gefühl für’s Material
Die großen Marken sponsern auch aus Erkenntnisinteresse Profiteams und Einzelfahrer oder -fahrerinnen. Mehr Praxis und feinere Sensoren als die Cracks hat wohl kaum jemand. Außerdem greift Schwalbe auf ein Netzwerk ambitionierter Laien zu, wenn es um den Check einer Neuentwicklung geht. „Das sind Leute, die nicht nur viel fahren, sondern auch sehr bewusst wahrnehmen, was das Material macht“, erklärt Produktmanager Robert Mennen. „Und selbst bei bewährten Testern, Fahrern aus dem Kollegenkreis und den Teams versuchen wir, die Fahreindrücke so objektiv wie möglich abzusammeln. Dazu gehört die Anonymisierung der Testreifen, also keine Angabe zum Modellnamen, der Karkasse oder dem Compound. Wir achten auch drauf, dass es keine Absprachen untereinander gibt. Sonst haben wir leicht einen Meinungsführer und es entscheidet die Psychologie, nicht das Fahrgefühl.“ Um ganz sicher zu gehen, bekommen die Tester manchmal im Laufe einer Testreihe denselben Reifen zweimal untergeschoben, ohne es zu wissen.
Die von Schwalbe gesponserten Downhiller des Teams Commencal / Muc-Off, unter ihnen der mehrfache Weltcup-Gesamtsieger Amaury Pierron, begnügten sich zudem nicht mit einer Rolle als Testfahrer. Sie griffen selbst zu Messern und Zangen, um das Material zu optimieren. Am Profil des serienmäßigen „Big Betty“-Reifens schnipselten sie so lange herum, bis das Fahrverhalten ihren Wünschen näherkam. Mit dem Ergebnis stießen sie dann beim Sponsor die Entwicklung des neuen Downhill-Modells „Tacky Chan“ an. Robert Mennen, als Ex-Profi selbst ein Gummi-Feinschmecker, erklärt das Resultat: „Wir haben die Mittelstollen verändert und mehr Raum zwischen ihnen und den Schulterstollen gelassen. Die wiederum haben wir verstärkt. Jetzt ist der Reifen leichter und allgemein agiler, aber, wie gewünscht, auch bissiger und präziser auf der Kante. Der will sehr aktiv gefahren werden. Es ist also eher kein Reifen für Tourenbiker.“
Es ist ein neuer Reifen für eine sehr spezielle Nische. Und von denen gibt es fast so viele, wie es Bikerinnen und Biker gibt. Schwere Fahrer auf Wurzeltrails, leichte Bikerinnen in Granit- oder Kalkfelsen, Speedjunkies im Stadtforst: Jedes Anforderungsprofil ist speziell. Und für jedes gibt es irgendwo den passenden Reifen – oder er entsteht gerade in diesem Augenblick ...
Reifisch für Anfänger
Compound: Die Gummimischung oder Gummimischungen eines Reifens. Diese Mischung aus Dutzenden Zutaten, vom Farbstoff und Füllstoff über Öle bis zu verschiedenen Kautschuksorten, wird auf den Einsatzbereich des Reifenmodells abgestimmt und beeinflusst maßgeblich Grip, Leichtlauf und Verschleiß.
Dual/Triple Compound: Dual Compound bezeichnet entweder eine Kombination von härterem, leichter rollendem Gummi in der Mitte der Lauffläche und einem weicheren Gummi im Seitenbereich des Profils, oder eine zweilagige Konstruktion, bei der eine härtere untere Lage die Stollen stützt. Darüber liegt eine weichere, griffigere Mischung. Beim Triple Compound geht es um eine Kombination der beiden Dual-Compound-Varianten.
Karkasse: Die textile, tragende Grundkonstruktion eines Reifens. Üblicherweise besteht sie aus mehreren, überkreuzten Lagen paralleler Fäden (Polyamid, selten auch Baumwolle) sowie textilen Pannenschutzlagen.
Silica: „Pyrogenes Siliziumdioxid“ oder auch Kieselsäure. Als Füllstoff ersetzt Silica in hochwertigen Reifen teilweise andere Materialien wie Ruß. Dabei soll es gleichzeitig den Nassgrip, den Leichtlauf und die Lebensdauer des Compounds steigern.
TPI/EPI: „Threads per Inch“ oder „Ends per Inch“, auf Deutsch „Fäden pro Zoll“. Die Fadenzahl bezeichnet die Feinheit der Karkasse – mehr und damit feinere Fäden gelten als höherwertig. Achtung beim Vergleich: Manche Hersteller (wie Schwalbe und Maxxis) geben die Fäden bei einer einzelnen Lage an, andere addieren die grundsätzlich mehrlagigen Karkassen aufeinander.
Tubeless: Weil echte Tubeless-Reifen wie beim Auto am Bike zu steif und schwer würden, sind Bikereifen nur „Tubeless Easy“ oder „Tubeless Ready“. Sie müssen mit Dichtmilch gefahren werden. Erst die Dichtmilch hindert die Luft daran, durch die flexiblen Reifenflanken zu entweichen.

